Sonstige
30.07.2025: Einen Tiefpunkt in der Geschichte von Tangermünde erlebten die Bürger am 13. September 1617, als an drei Stellen zur gleichen Zeit gewaltige Brände aufloderten. Lediglich die Gebäude aus Backstein, welche zur Zeit der Hanse errichtet worden waren, wie Stadtmauer, Stadttore, Kirchen und der heutige Rathausanbau, blieben mehr oder weniger verschont. Grete Minde wurde für diese Tat zur Verantwortung gezogen. Das von der Stadt angerufene Schöppengericht der Mark Brandenburg verurteilte Grete Minde zum Tode. Am 22. März 1619 wurde das Urteil, ein qualvoller Tod auf dem Scheiterhaufen vollstreckt. Theodor Fontane setzte ihr in seiner gleichnamigen Novelle Grete Minde ein literarisches Denkmal. Bis heute ist die Schuld oder Unschuld dieser Frau am Stadtbrand und somit am Beginn des Niederganges der einst reichen Stadt nicht ganz geklärt. Tangermünder Bürger haben dieser Frau ein Denkmal gesetzt. Es wurde an Ihrem 390. Todestag am 22.03.2009 am Rathaus enthüllt, eine Erinnerung an Unrecht und Leid. Die Bronzeplastik ist eine echte Sehenswürdigkeit und steht neben der Gerichtslaube des Rathauses und wurde von Lutz Gaede, einem Künstler aus der Altmark erschaffen:




29.07.2025: Der Stendaler Roland, eine 1525 errichtete Rolandstatue auf dem Stendaler Marktplatz vor der Gerichtslaube des Rathauses, ist ein Wahrzeichen Stendals. Die Figur ist 7,80 Meter hoch. Der Roland ist ein städtisches Rechtssymbol, das die hohe Gerichtsbarkeit, Marktfreiheit oder bestimmte Stadtrechte verkörperte. Die Figur stellt den aus Liedern und Epen (Rolandslied) bekannten Heerführer Roland und angeblichen Neffen Karls des Grossen dar. Er ist als Ritter mit Schnurrbart dargestellt, der einen Plattenpanzer mit aufgelegten Wulsten trägt. In der rechten Hand trägt er ein eisernes Schwert mit ursprünglich vergoldetem Knauf und Griff, in der linken Hand hält er einen Schild mit dem städtischen Wappen, einen Brandenburgischen Adler, unter dessen Füssen zwei an den Ecken ausgezackte Quadrate (Steine) liegen. Um die Haare trägt er einen Reif in Form eines wulstförmigen Stoffbandes (Pausch), mit einem eisernen Kiefernzweig an der rechten Seite:
27.07.2025: Die Siegessäule wurde von 1864 bis 1873 nach den Plänen von Heinrich Strack ursprünglich auf dem Königsplatz vor dem Reichstag (dem heutigen Platz der Republik) errichtet. Anlass zur Erbauung war der Sieg Preussens im Deutsch-Dänischen Krieg 1864. Innerhalb weniger Jahre kamen zwei weitere siegreiche Kriege hinzu, der Deutsche Krieg 1866 gegen Österreich sowie der Deutsch-Französische Krieg 1870/1871. An diese drei Siege – heute Einheitskriege genannt – sollten die drei Säulensegmente ursprünglich erinnern. An den Bronzereliefs und Mosaikbildern im Säulengang können Sie den Weg zur Gründung des Deutschen Reichs nachverfolgen. Während des Nationalsozialismus wird die Siegessäule um eine vierte Trommel erhöht, so dass sie heute eine Gesamthöhe von 67 Metern besitzt. 1938/39 lässt man zudem für die geplante Umgestaltung von Berlin in die Reichshauptstadt Germania das Denkmal rund 1,6 km nach Westen versetzen – auf den Grossen Stern inmitten des Tiergartens, wo sie auch heute noch steht. Nachdem sie den Krieg weitgehend unbeschadet überstanden hat, wurde die Siegessäule Mitte der 1980er Jahre restauriert und steht heute unter Denkmalschutz:





26.07.2025: Rolandsfiguren stammen aus dem Mittelalter und symbolisierten die städtischen Freiheiten und die Unabhängigkeit der Stadt. Schon 1419 muss es eine Roland Figur in Magdeburg gegeben haben. Es gibt schriftliche Erwähnungen, in denen von einer Aufstellung eines neuen Rolands berichtet wird. Diese Figur zerstörte man im Dreissigjährigen Krieg. An dem Standort befindet sich heute eine Platte im Boden mit der Aufschrift Roland 1727. Fast 2 Jahrhunderte hatte Magdeburg keine Rolandsfigur. Erst im Ersten Weltkrieg schuf Rudolf Bosselt eine hölzerne Figur, den Nagelroland. Hier sollten Nägel Spenden symbolisieren, die für Familien von gefallenen Soldaten gedacht waren. Man entschied, die Figur lieber zu erhalten und verzichtete auf das Einschlagen der Nägel. Nachdem die Figur einige Jahre im Museum gestanden hatte, stellte man sie 1933 wieder vor dem Rathaus auf. In den Nachkriegszeiten wurde der Roland anscheinend zu Brennholz verarbeitet, er war auf einmal verschwunden. Nach der politischen Wende gab es Bestrebungen einen neuen Roland aufzustellen. Die Bildhauerin Martina Seffers schuf den heutigen Roland nach einer alten Abbildung. Seit 2005 steht der Magdeburger Roland nun wieder vor dem Rathaus:

26.07.2025: Bereits um 1240 geschaffen, stellt der Magdeburger Reiter vermutlich Kaiser Otto I. dar. Die beiden allegorischen Begleitfiguren zu seiner Seite sind zwei Mägde. Die eine der beiden hält ein Schild mit dem Reichsadler, die andere fasst eine Fahnenlanze, zwei Hoheitssymbole des Kaisers. Das Original des Standbildes zog im Jahre 1967 in das Kulturhistorische Museum der Stadt, wo es auch heute noch besichtigt werden kann:

26.07.2025: Die Bronzestatue wurde 1886 von Emil Hundrieser geschaffen, um an die Predigt Martin Luthers in der nahe gelegenen Johanniskirche am 26. Juni 1524 zu erinnern. Nach dieser Predigt trat die Magdeburger Altstadt geschlossen zum Protestantismus über:
25.07.2025: Auf dem Wolfenbütteler Marktplatz wurde dem Herzog ein Denkmal in Form eines Brunnens gesetzt. Das Denkmal entwarf der Bildhauer Georg Meyer-Steglitz (1868-1929), es wurde im Jahr 1904 eingeweiht und zeigt einen Herzog mit Schlapphut und Stulpenstiefeln, der in der Jagdpause sein müdes Pferd zur Tränke führt. Was für ein Gegensatz zu anderen Reiterdenkmalen:
24.07.2025: Die Legende der Wildschweinrotte erzählt, dass die Tiere mit ihren silberglänzenden Borsten die damaligen Bewohner auf den hohen Salzgehalt des Wassers aufmerksam machten und so die sichere Existenz als Salzsieder entstand. Der Künstler ist unbekannt, die Wildschweine wurden 1999 aufgebaut:
24.07.2025: In Salzgitter-Bad wurde im Herbst 2009 der Gradierpavillon im Rosengarten innerhalb der Traditionsinsel feierlich eingeweiht. Schirmherr, Oberbürgermeister Frank Klingebiel, gehörte ebenso zu den Festrednern wie der Vorsitzende des Bürgervereins, Joachim Sievers. Knapp zwei Jahre rief der Verein zum gemeinschaftlichen Spenden für den Gradierpavillon auf. Rund 400 Bürger kamen dem Ruf nach. Die Arbeiten begannen mit der Erneuerung des Rohrsystems an der Soleleitung, einer Tiefbaumassnahme, die der eigentlichen Errichtung des Gradierpavillons vorausging. Damit wurde die wichtige Voraussetzung für das spätere Holzgerüst mit Reisigbündeln geschaffen. Anschliessend konnte der Pavillon über der Quelle errichtet werden:
















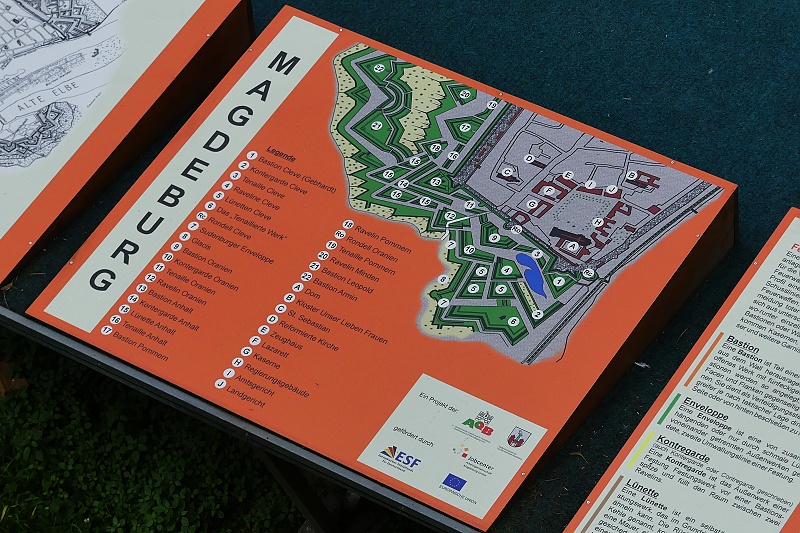
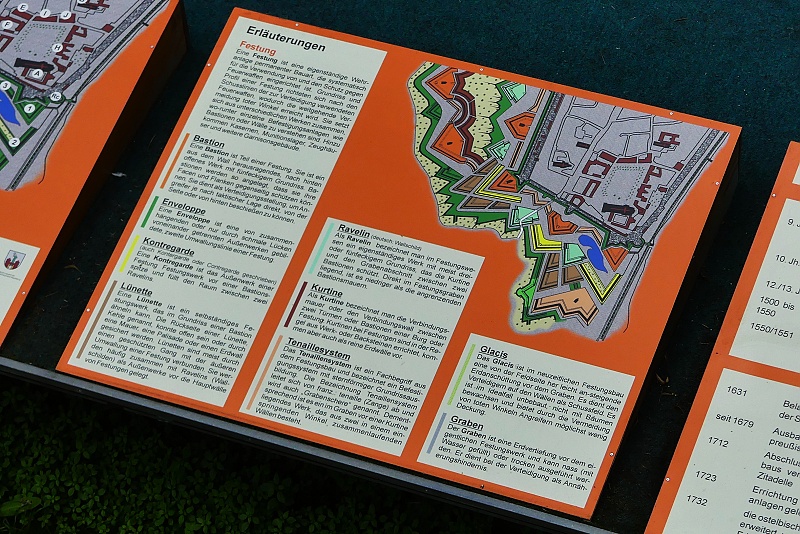





 Users Today : 203
Users Today : 203 Users Yesterday : 1065
Users Yesterday : 1065

















