Baudenkmäler und Sehenswürdigkeiten
11.07.2024: Auf der Südseite der Klosterkirche umschlossen ursprünglich die Konventsgebäude vollständig den Kreuzgang. Der an die Kirche angrenzende Nordflügel sowie das östliche Konventsgebäude wurden 1819 abgebrochen. Die bis heute erhaltenenen und gegenwärtig von der Caritas genutzten Gebäudeflügel sind zurückhaltende Barockbauten aus der Amtszeit des Abtes Andreas Brandt (1681-1725). Der Südflügel stammt von 1709, der im Westen von 1711-12. Der Prälatenbau von 1716-20 in der Verlängerung des Südflügels nach Westen liess einen L-förmig begrenzten Hof entstehen, der in der Nahsicht den Blick auf die Westfassade der ehemaligen Klosterkirche räumlich fasst. Die Aufrisse der Konventsbauten aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts werden bestimmt von dreiachsigen Querhäusern, in deren Mittelachse im Erdgeschoss jeweils ein Portal mit gesprengtem Segmentgiebel:

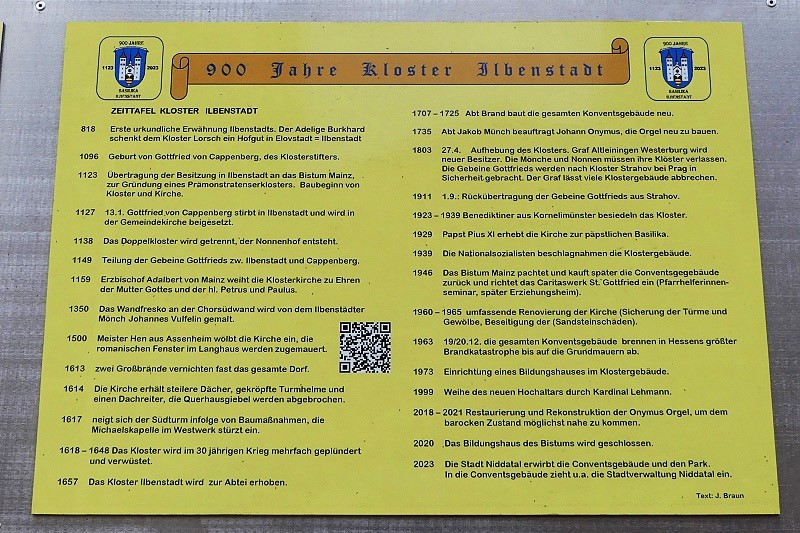


Die 1159 geweihte ehemalige Abteikirche Maria, St. Petrus und Paulus wurde im romanisch-basilikalen Stil gebaut. Um 1500 wurde die bisher flache Holzdecke gotisiert. 1681 bis 1699 schuf Johann Wolfgang Frölicher Skulpturen und Altäre sowie die Kanzel für die Klosterkirche. Im Zuge der Barockausstattung der Abteikirche liess Abt Jakob Münch in den Jahren 1732 bis 1734 durch Franz Vossbach die Orgelempore und den Orgelprospekt aufrichten. Dazu erstellte Johann Onimus aus Mainz die bis heute existierende Orgel. 1803 wurde die Abteikirche im Zuge der Säkularisation zur Pfarrkirche. Das kostbare Inventar der vormaligen Klosterkirche wurde verschleudert. Am 23. Februar 1929 wurde die Kirche durch Papst Pius XI. mit dem Apostolischen Schreiben Monasterii Sancti Benedicti zur Basilica minor erhoben. Die 1960 bis 1970 gründlich renovierte Basilika ist auch heute noch eine imposante Kirche und trägt im Volksmund den Namen Wetterauer Dom:


Der zweigeschossige Nördliche Torbau des Klosters – der Schlussstein des auf der Seite des Klosterbezirks gelegenen Torbogens trägt als Inschrift die Jahreszahl 1603, die kleinere Pforte daneben im Bogenscheitel 1588. Das Obergeschoss ist in Fachwerk gehalten, hier befand sich ursprünglich die Klosterschule:




Der Südliche Torbau des Klosters – 1721 als zweigeschossiger Bau mit Mansarddach und seitlichem Treppenhaus errichtet, im Obergeschoss befindet sich ein Festsaal mit Stuckdecke. Bemerkenswert ist die bewegte architektonische Gliederung und der reiche, plastisch hervortretende Bauschmuck. Die Entstehung des Baus fällt in eine Blütezeit des Klosters unter Abt Andreas Brandt, der von 1681-1725 amtierte. Der den Klosterbezirk nach Süden verlassende Weg wird auf der östlichen Seite von der Bruchsteinmauer des Klostergartens begleitet:


Westlich unmittelbar vor der ehemaligen Klosterkirche steht ein zweigeschossiger Massivbau mit Krüppelwalmdach, inschriftlich in einem Türsturz 1705 datiert. Er ist von einem Hof mit mehreren Nebengebäuden umgeben, die ebenfalls denkmalwerter Bestandteil des klösterlichen Bauensembles sind. Der Hof wird auf seiner Nordseite von der alten Zehntscheune des Klosters begrenzt, die auch von hier aus zugänglich ist:

11.07.2024: Die 1159 geweihte ehemalige Abteikirche Maria, St. Petrus und Paulus wurde im romanisch-basilikalen Stil gebaut. Um 1500 wurde die bisher flache Holzdecke gotisiert. 1681 bis 1699 schuf Johann Wolfgang Frölicher Skulpturen und Altäre sowie die Kanzel für die Klosterkirche. Im Zuge der Barockausstattung der Abteikirche liess Abt Jakob Münch in den Jahren 1732 bis 1734 durch Franz Vossbach die Orgelempore und den Orgelprospekt aufrichten. Dazu erstellte Johann Onimus aus Mainz die bis heute existierende Orgel. 1803 wurde die Abteikirche im Zuge der Säkularisation zur Pfarrkirche. Das kostbare Inventar der vormaligen Klosterkirche wurde verschleudert. Am 23. Februar 1929 wurde die Kirche durch Papst Pius XI. mit dem Apostolischen Schreiben Monasterii Sancti Benedicti zur Basilica minor erhoben. Die 1960 bis 1970 gründlich renovierte Basilika ist auch heute noch eine imposante Kirche und trägt im Volksmund den Namen Wetterauer Dom:



11.07.2024: Mit 45 Meter Höhe ist das Mühlsilo ein Wahrzeichen des Ortes und der Wetterau geworden. Bereits 1294 wurde die Mühle erstmals erwähnt. An den unterschiedlichen Baustilen ist der Wandel von der Wassermühle zur industriellen Walzmühle eindrucksvoll abzulesen. Um die Wasserkraft effektiv nutzen zu können, musste die Nidda gestaut und umgeleitet werden. Erst als die Wasserkraft nicht mehr ausreichte, wurde 1909 zur Unterstützung eine Dampfmaschine eingesetzt. Ihre Blütezeit erfuhr die Mühle in den 1950er Jahren. Während dieser Zeit beschäftigte die Walzenmühle Assenheim AG 100 Menschen, die bis zu 80 Tonnen Getreide in 24 Stunden vermahlen konnten. Zu den Grosskunden gehörten der Kindernahrungshersteller Milupa und die Zwiebackfabriken in Friedrichsdorf. Der Mühlbetrieb wurde 1972 eingestellt, das ganz früh in Gleitschalungstechnik errichtete Silo wird bis heute als Getreidelager genutzt:



11.07.2024: Die Kirche wurde 1782 bis 1785 nach den Plänen des Nauheimer Bauschreibers Joh. Philipp Wörrishöffer erbaut. Vom Baustil her an den Klassizismus angelehnt, hat sie an der östlichen Eingangsfront in der zentralen Achse einen vorgezogenen Anbau für das Treppenhaus (Risalit). Auf der gegenüberliegenden Seite des rechteckigen Kirchenraumes steht der Glockenturm, der oben mit einer welschen Haube abgeschlossen ist. Unter dem Helm läuten drei Glocken, darunter die über 600 Jahre alte Evangeliumsglocke. In den Jahren 2002 bis 2004 wurde das Gebäude aussen saniert, 2006 der Platz vor und um die Kirche erneuert. Den Abschluss der umfangreichen Renovierungsarbeiten bildete im Jahr 2012 die Innenrenovierung.
2018 musste der Platz teilweise wiederhergestellt werden, weil die alte Linde einem Gewittersturm zum Opfer gefallen war und durch eine neue Linde ersetzt wurde:


11.07.2024: Das zweigeschossiges Gebäude mit Mansarddach und Querhaus in der Mittelachse der Strassenseite wird als Rentkammer der Grafen von Solms-Rödelheim und Assenheim überliefert, gegenwärtig wird es zum Wohnen und als Postdienststelle genutzt. Die Strassenfront zeigt den ursprünglichen spätbarocken-klassizistischen Gebäudetyp mit einer durch sieben vertikale Achsen geordneten Fassade, in der Mittelachse der Eingang mit zweiläufiger Freitreppe und das schon angeführte Querhaus:


11.07.2024: Schloss Assenheim geht auf eine mittelalterliche Burg zurück, die wohl zwischen 1170 und 1184 entstanden sein muss. Bauherr war vermutlich Kuno I. von Münzenberg. Die Anlage wurde als Wasserburg konzipiert, der Burgturm ist auf vielen alten Zeichnungen und Stichen zu finden und war prägend für das Stadtbild. Im Jahr 1574 wurde der erste Schlossbau durch die Grafen von Solms direkt an die Stadtmauer unweit der Burg errichtet. Die Burg wurde dann im Jahr 1779 abgebrochen, heute erinnern nur noch einzelne Mauerreste der Ringmauer an deren Existenz. Der Beginn des Schlosses ist auf die Jahre 1788 bis 1790 beziffert, als die ersten Gebäudeteile entstanden – damals waren dies zwei Achsen des Mitteltraktes. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte kamen immer weitere Gebäudeteile dazu, so ein Arkadenvorbau, der 1874 entstand. 1786 bereits entstand der Schlosspark, der 1850 in einen Englischen Garten umgestaltet wurde. Von 1924 bis 1932 wurde im Schloss eine Begegnungsstätte für Wissenschaftler eingerichtet. Noch heute wohnt die Familie zu Solms-Rödelheim im Schloss, weswegen es leider nicht besichtigt werden kann. Allerdings kann auf dem Anwesen im neu geschaffenen Trausaal geheiratet werden:

Neugotischer Archivbau mit Teilen der mittelalterlichen Ringmauer:

Bereits beim Bau der Assenheimer Burg durch die Münzenberger gab es einen zugehörigen Ökonomie-Komplex aus ehemals Fuldaer Besitz. Entsprechend der weiteren Eigentumsentwicklung an Burg und Stadt Assenheim nach dem Falkensteiner Erbfall von 1418 wurde im 15. Jahrhundert auch der Ökonomie-Hof zwischen den Häusern Isenburg und Solms geteilt. Fortan bestanden zwei Höfe nebeneinander, bis 1857 die Grafen von Solms-Rödelheim durch Aufkauf des Isenburger Anteils wieder für einheitlichere Verhältnisse sorgten. Die erhaltenen Baulichkeiten stellen sich gegenwärtig von der Strasse aus als dreiseitige Hofanlage dar mit einem riegelartigen Ausleger an der Süd-Ost-Ecke:







 Users Today : 299
Users Today : 299 Users Yesterday : 672
Users Yesterday : 672











